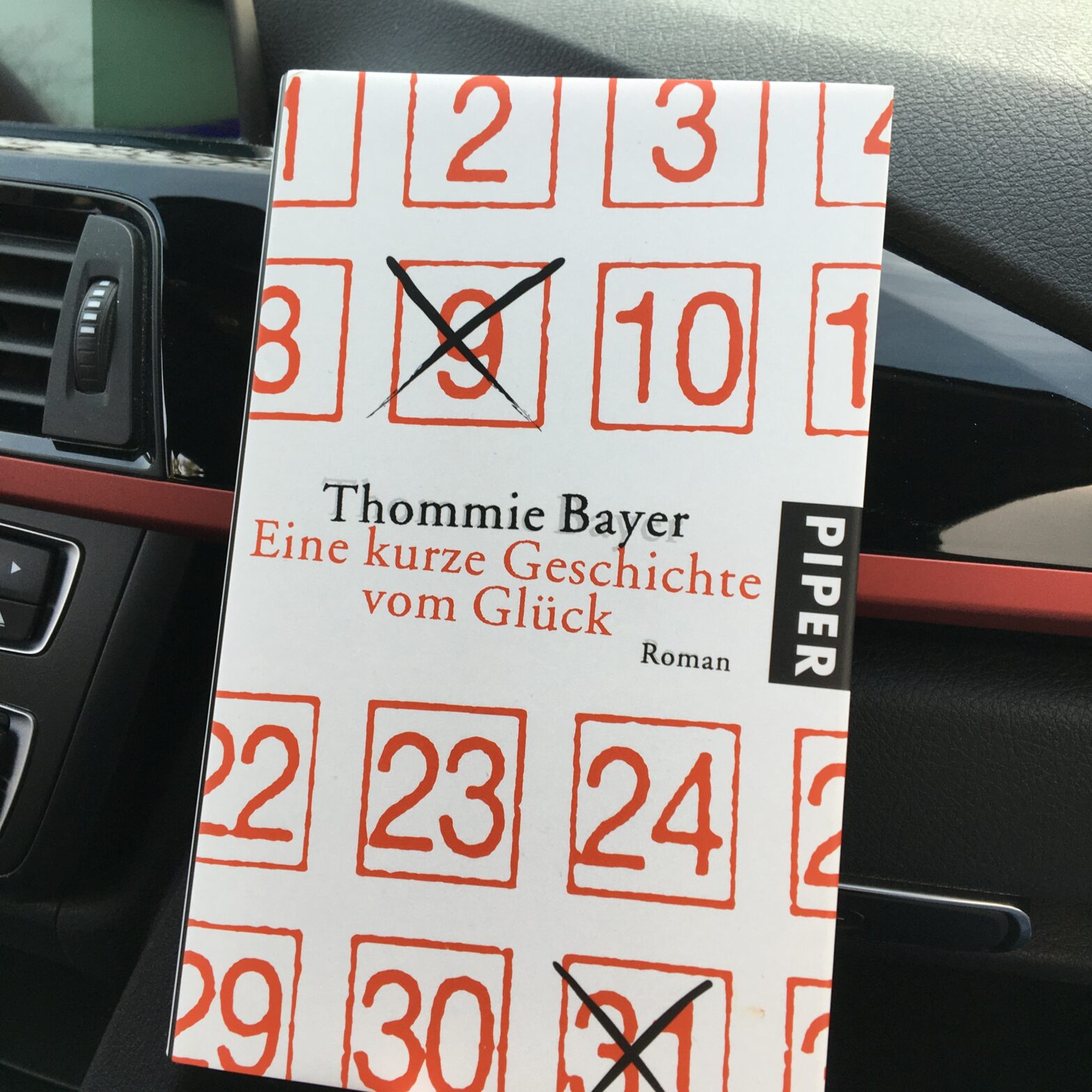Das Cover des Romans „Pantopia” von Theresa Hannig ist schwarz-grün gestaltet. Ob der Verlag für den Herbst 2021 auf eine schwarz-grüne Bundesregierung spekuliert hatte?
Das politische Farbenspiel, das man der Covergestaltung entnehmen könnte, gibt jedenfalls die Richtung dieses Buches vor. Umweltschutz erreichen, aber bitte mit den Mitteln des „perfekten Kapitalismus“, wie es im Buch heißt. Und es ist ja der konservative Kern der grünen Partei in Deutschland, das aktuell herrschende Wirtschaftssystem zu bewahren und als Instrument für die eigenen Ziele zu nutzen. Schwarz-grün ist eben auch die Welt in diesem Zukunftsroman, der sich dank seiner zentralen Idee zur Utopie steigert.
Die Mittzwanzigerin und Multimilliardärin Patricia Jung – neben dem gleichalten und ebenfalls steinreichen Henry Shevek Hauptperson des Romans – stand folgerichtig der Bewegung Fridays for Future nahe. Es ist ein Stück weit diese junge Generation, der „Pantopia“ eine Stimme verleiht. Und etwas erstaunt liest es sich schon, dass diese Generation so absolut auf Affirmation statt Kritik setzt und den Planeten mit den Instrumenten des bestehenden Systems retten möchte. Ob es damit zu tun hat, dass sie – aufgewachsen mit dem Smartphone in der Hand und dem Selbstverständnis, mehrmals im Jahr in entfernte Länder zu reisen – wie kaum eine zuvor von der Zerstörung des Planeten profitiert hat? Geht es bei der Vermeidung von kritischen Entwürfen zur Frage, wie wir anders und umweltschonender leben wollen, um Besitzstandswahrung? Das System erhalten, um den Verlust des hohen Lebensniveaus nicht zu riskieren? Andererseits: Kritisch war die Generation der 68er bis zum Anschlag. Gebracht hat es nichts. Zuhören darf man der jungen Generation und ihrem Entwurf in jedem Fall.
Also: Braucht es lediglich genug Kapital und alles wird gut? „Die Redewendung ‚Geld regiert die Welt‘ ist wahrer, als den meisten Menschen bewusst ist“ (S. 332). So sinniert denn auch an einer Stelle des Buches Einbug. Einbug? Das ist die Künstliche Intelligenz, die im Roman von den beiden Programmierern Patricia und Henry entwickelt wird (wodurch die beiden zu Multimilliardären wurden) und die aufgrund eines Bugs zu einer sogenannten starken KI erwächst: Sie hat Selbstbewusstsein, kann selbstständig denken. Diese revolutionäre Erfindung steht im Zentrum von „Pantopia“. Und diese Software arbeitet mit ihrem unglaublich großen Datenvolumen an der Instrumentalisierung des Kapitals zu Zwecken des Umweltschutzes.
Auch bei dieser Konzeption bzw. allein schon beim Namen der KI mit ihrem Wortbestandteil „Ein-“ wird die schwarz-konservative Ausrichtung des Buches deutlich. Die klassische Philosophie samt Platon und Plotin bis hinein in die Moderne lässt grüßen. Denn diese hielt es ja ganz gerne mit dem Einen als Prinzip (auch wenn es wie bei Hölderlin und anderen das „Eine in sich unterschiedene“, also doch wieder zweigeteilt war). Die großen Religionen dieser Welt nicht zu vergessen, die bekanntlich Monotheismen sind.
Es ist diese Liebe zum Subjekt, zum Einen und Einzigen, an der die Generation von Fridays for Future festhält. So muss man bei der Lektüre von „Pantopia“ schlussfolgern. Das muss man auch den Worten eines jungen Mitstreiters von Pantopia namens Tom entnehmen. In einem Streitgespräch mit seinem Vater zur Frage nach der Rettung des Planeten, was die Elterngeneration bisher dafür getan habe und die junge Generation nun zu tun gedenke, ruft er – in die Ecke – gedrängt schließlich aus: „Das ist meine Zukunft! Mein Leben!“ (S. 405) Bei so viel Ichbezogenheit ist man eben doch ein bisschen baff. Den Planeten retten, um selbst ein angenehmes Leben zu führen? Warum wird das Umweltthema so sehr auf das Ich heruntergebrochen? Erneut: Geht es um den Planeten (Objekt) oder das eigene Leben (Subjekt)? Und sind Ichliebe und der Wunsch nach höchstem Komfort, die der Kapitalismus bedient, nicht die Ursachen der Zerstörung von Klima und Umwelt? Kann die Ursache des Problems die Lösung sein?
In Theresa Hannigs Roman jedenfalls geht es um den perfekten Kapitalismus, der in Pantopia Unternehmen und Produkte via Preisgestaltung unterstützt – oder bestraft. Je nachdem, ob die Produkte umweltschonend und fair hergestellt wurden und aus der näheren Region kommen oder nicht. So herrscht in Pantopia die reine Vernunft. Allerdings nur, weil es Zwänge gibt. „Was gut ist, wird verstärkt. Was falsch ist, wird bestraft“ (S. 178). Das klingt nicht ganz so heimelig. Allerdings gibt es einen reichen Segen für alle, die bei Pantopia mitmachen: Es lockt ein bedingungsloses Grundeinkommen von rund 3000 Euro monatlich. Hannig lässt auch den berühmtesten Anhänger der reinen Vernunft zu Wort kommen: Immanuel Kant. Die Stelle erinnert übrigens etwas an die entsprechende Passage des Romans „Sophies Welt“ von Jostein Garder. In ähnlichem Ton schließt Hannig Kant mit dem Entstehen der UNO kurz. So schließt sich der Kreis. Die vernunftbegabte KI Einbug leitet und lenkt Preise und Geldströme auf dem Weltmarkt, die vernunftbegabten Mitglieder der Weltrepublik Pantopia führen ein zufriedenes Leben.
Vernünftig ist auch das Ziel, andere Menschen nicht als Mittel zum Zweck zu gebrauchen. Auch hier darf der Name Kant fallen. Es war immerhin die Basis seiner Moralphilosophie. Nur: Um Informationen über die Menschen zu erhalten, liest Einbug alle möglichen Bücher, die über Jahrhunderte hinweg publiziert wurden. Schön und gut. Aber er studiert eben auch mit gleicher Priorität Posts auf Social Media. Weil die Vernetzung der Menschen eine zentrale Rolle in diesem Buch einnimmt, spielt auch das Followersystem der sozialen Medien eine wichtige Rolle: Posts und Poesie werden im Roman „Pantopia“ gleichgestellt. Nur ist das so? Schaut man sich die sozialen Medien an, könnte man auf den Gedanken kommen, dass sich gerade hier Menschen gegenseitig als Mittel zum Zweck benutzen. Entweder, um beruflich voranzukommen (Xing, LinkedIn), oder um den privaten Account zu pushen oder für einen anderen Zweck zu nutzen (Instagram, Facebook, TikTok). Aber klar – so negativ oder gar unmoralisch muss man diese Medien nicht sehen und nutzen.

Hannig hat mit ihrem Buch „Pantopia“ ein modernes Märchen verfasst. Dafür nutzt sie versiert die gängigen Strategien der Spannungsbildung. Dass nach der ersten Hälfte des Romans auf einmal ganz andere Figuren auftauchen, die das Geschehen von einer komplett anderen Seite beleuchten und der Geschichte neuen Drive geben, und ihre Handlungen mit dem ersten Erzählstrang von Patricia und Henry verwoben werden, ist ein solches Mittel. Dass es sich dabei um eine Kommissarin und eine Journalistin handelt – zwei Aufklärertypen, Figuren, die etwas aufdecken und rausfinden können –, ist übrigens recht stark dem Schema des Heftromans entliehen. Und auch, dass diese beiden Figuren übertrieben böswillig angelegt sind. Gerade durch diese übertriebene Zeichnung vermeidet es die Autorin, ihren Figuren eine charakterliche Tiefe mit auf den Weg zu geben. Bei einem realistischen Erzählansatz müssten nun alle Alarmglocken schrillen. In einem Märchen, in dem auch mit Unwahrscheinlichkeiten gedealt wird, braucht es dies natürlich nicht. Ihre Stärke für den utopischen Entwurf des Romans gewinnen die Figuren aus ihrer Andeutung.
Dasselbe gilt für die beiden Hauptfiguren, die sehr holzschnittartig angelegt sind. „Ihr Herz gefror zu Eis“ (S. 393), so kurz und knapp ist einmal von Patricias immer wieder unter der Oberfläche brodelnden Gefühlen für einen Mann zu lesen.
Die Märchenstrategie gilt auch für das ein oder andere Logikproblem, über das man bei der Lektüre stolpert. Als die Anhänger Pantopias ein Demonstrationscamp ins Leben rufen, bauen sie mit großem Aufwand einen Schutzwall auf. Offenbar mit Erfolg:
„In der Nacht hatten die Demonstrierenden die Autos […] auf die Zufahrtstraßen gelenkt und dort abgestellt. Vielen Fahrzeugen hatten sie außerdem die Reifen abmontiert, damit sie nicht abgeschleppt oder weggeschoben werden konnten. Als die Wasserwerfer anrückten, stießen sie auf eine Wand von unverrückbaren tonnenschweren Autokarosserien. Zuerst wurde versucht, die Wagen beiseitezuschieben, doch sie verkeilten sich dadurch nur noch mehr und wurden zu einem unüberwindlichen Hindernis[.] Am Nachmittag gab die Polizei auf“ (S. 418–419).
Doch nur wenig später heißt es von den Demonstrierenden selbst: „Obwohl das Camp über Nacht schon wieder über die Grenzen der letzten Autoblockade hinausgewachsen war, war es ein Leichtes gewesen, die Barrikaden am nächsten Morgen einfach um ein paar Meter zu verschieben. Dutzende junge Männer und Frauen trugen die Autowracks die Straßen entlang“ (S. 420).
Wie geht das? Was der Staatsmacht nicht gelang, schaffen die jungen Leute im Handumdrehen? Es sind Stellen wie diese, an der die wundersame Wunschwelt des Märchens deutlich wird.
Auch bei anderen Stellen könnte man sich fragen, ob diese als Plädoyer für Umweltschutz gut gewählt sind. Als Patricia lediglich für ein Interview von Griechenland nach Deutschland fliegt, denkt man unwillkürlich an die Möglichkeit von Videochats. Auf der anderen Seite findet sich in diesem Buch eine ikonische Szene, die alle ansprechen dürfte, die schon mal in einem (Großraum-)Büro saßen: Eines Abends nämlich, als Patricia länger im Büro war und alle anderen längst gegangen sind, schreitet sie an allen ausgeschalteten Rechnern vorbei und macht die Bildschirme aus. Es ist ein Faszinosum, dass viele Menschen, die den Müll trennen und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, ihren Monitor am Arbeitsplatz nach Feierabend gerne anlassen. Hier gelingt Hannig ein schönes Bild.
Doch das sind nur einzelne Szenen und vereinzelte Assoziationen. Dem Roman „Pantopia“ von Theresa Hannig geht es tatsächlich um etwas Großes. Das sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Die Autorin hat sich mit diesem Buch literarisch an die Umsetzung eines neuen Gesellschaftsvertrags gemacht, den alle Mitglieder der neuen Weltrepublik Pantopia laut ihrer Satzung eingehen. Dieser Entwurf ist bewundernswert. Der Philosoph John Rawls dürfte dafür Pate gestanden haben. „Wahrheit ist schön“, sagt Einbug im ersten Teil des Buches immer wieder. Der spannende geschriebene Pageturner „Pantopia“ überzeugt deswegen auch als sehr gut lesbare Ästhetisierung des vernunftbegabten Denkens.